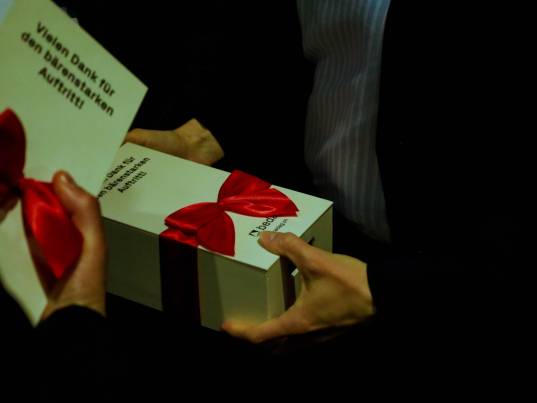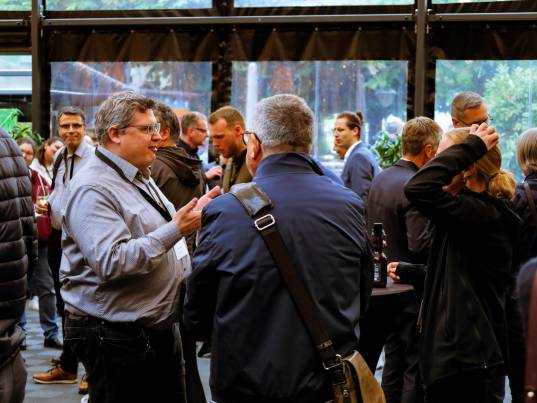Datum
12.05.2025
Die Digitalisierung ist längst in den Verwaltungen angekommen – doch wie gelingt sie erfolgreich und bietet einen Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger? Wo liegen die Herausforderungen und welche Erfolgsfaktoren haben sich bewährt?
Antworten auf diese Fragen erhielten die rund 250 Gäste am Innovationshalbtag und Frühlingsapéro der Bedag am 8. Mai 2025 in der Berner Kulturinstitution «Bierhübeli». Ausgewiesene Expertinnen und Experten boten den Gästen Einblick in ihre Tätigkeit und Erkenntnisse rund um die Digitalisierung der Verwaltung.
Als Keynote Speaker konnte Benjamin B. Bargetzi gewonnen werden, einer der führenden Denker und Pioniere Europas in den Bereichen KI, Zukunft der Gesellschaft, Psychologie und Neuroforschung. Insights aus der öffentlichen Verwaltung boten Syrian Hadad - CTO des Kantons Aargau, Michael Kammerbauer - Leiter der Geschäftsstelle Digitale Verwaltung des Kantons Bern und Dr. Alexandra Collm - Leiterin der Hauptabteilung Kunden und Mitglied der Geschäftsleitung der Organisation und Information der Stadt Zürich (OIZ). Thomas Alabor von der Bedag erläuterte diese Themen aus Sicht eines IT-Dienstleisters.
Die nachfolgenden Key Findings der Referentinnen und Referenten dürfen wir hier einem breiteren Publikum zugänglich machen:
Benjamin B. Bargetzi: Neuroforschung trifft KI: Was in der Welt geschieht und warum uns Veränderung so schwerfälltWarum verläuft der digitale Wandel in der öffentlichen Verwaltung oft langsamer und restriktiver als in anderen Organisationen und wie kann er beschleunigt werden? Was können wir von anderen Ländern für die Zukunft lernen?
In seinem Vortrag beleuchtete Benjamin B. Bargetzi, warum der digitale Wandel in der öffentlichen Verwaltung oft langsamer und restriktiver verläuft als in anderen Organisationen. Mithilfe aktueller Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft erklärte er, welche kognitiven Mechanismen und kulturellen Faktoren Innovation ausbremsen – und wie sie beschleunigt werden können.
Mit einem Blick über die Landesgrenzen zeigte er, wie andere Länder und Tech-Giganten mit der Digitalisierung umgehen: Welche Prinzipien die USA, Saudi-Arabien, China oder das Silicon Valley verfolgen, wie sich ihre Kultur vom Schweizer Verwaltungsdenken unterscheidet und was wir daraus für die Zukunft lernen können.
Benjamin B. Bargetzi zählt zu den führenden Denkern und Pionieren Europas in den Bereichen KI, Zukunft der Gesellschaft, Psychologie und Neuroforschung. Seine Arbeit beschäftigt sich primär mit der Frage, wie Menschen, Organisationen und ganze Kulturen mit Veränderung umgehen – oder eben nicht.
Syrian Hadad: Digitale Transformation im Public Sector - Geheimzutaten für digitale ErfolgsgeschichtenWie setzen wir Digitalisierungsprojekte erfolgreich um, damit digitale Transformation nicht nur ein Buzzword bleibt, sondern echte Mehrwerte schafft?
In seinem Referat gab Syrian Hadad spannende Einblicke in die digitale Transformation des Kantons Aargau. Er zeigte, wie griffige Governance-Instrumente, ein evolutiver Ansatz statt radikaler Umbrüche und die Demokratisierung der Entwicklung echte Veränderung ermöglichen. Besonderes Augenmerk lag auf dem modernen Portal des Aargaus, das Kanton und Gemeinden auf einer Plattform vereint. Ergänzt wurde die Reise durch konkrete Beispiele für den KI-Einsatz – von der Transkription von Schweizerdeutsch bis hin zu VoiceBots, die eigenständig Informationen aus Dokumenten suchen. Den Teilnehmenden bot sich ein erfrischender Blick darauf, wie Innovation im öffentlichen Sektor erfolgreich umsetzbar ist.

Syrian Hadad ist CTO des Kantons Aargau und treibt die digitale Transformation der Verwaltung voran. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung kombiniert er Technologie und Geschäftsstrategie, modernisiert IT-Infrastrukturen und setzt sichere, skalierbare Architekturen um.
Unter seiner Leitung entstanden wegweisende Plattformen wie das Smart Service Portal für Kanton und Gemeinden oder die Aargau Cloud Plattform sowie verschiedene KI-Projekte. Durch Low-Code-Plattformen beschleunigt er die Entwicklung digitaler Services. Sein Engagement trug zur Auszeichnung des Kantons Aargau mit dem Digital Economy Award 2023 bei. Als Redner, Fachautor und Dozent teilt er sein Wissen zur digitalen Transformation und Cloud-Modernisierung. Sein Ziel: Verwaltungen und Unternehmen mit Spitzentechnologie nachhaltig zu transformieren.
Michael Kammerbauer: Digitale Transformation - zwischen Angst und AufbruchDie digitale Transformation verändert nicht nur Prozesse, sondern vor allem uns Menschen. Sorgen, Unsicherheiten und Widerstände können den Wandel bremsen. Wie gehen wir damit um? Wie können wir Digitalisierung als Chance begreifen – ohne uns dabei verloren zu fühlen?
Die digitale Transformation betrifft nicht nur Technologie – sie fordert vor allem einen kulturellen Wandel. Während Tools und Systeme technisch oft schnell verfügbar sind, scheitert der Wandel häufig an Ängsten, Unsicherheit und mangelnder Beteiligung. Fachbereiche fühlen sich fremdgesteuert, IT begegnet Widerständen. Zwei Fallbeispiele – die Einführung eines digitalen Formulars und von Kollaborationsplattformen – zeigen: Ohne Nutzerzentrierung und kulturelle Einbettung entsteht kein echter Fortschritt.
Im Zentrum erfolgreicher Transformation steht der Mensch. Nicht Perfektion, sondern Partizipation entscheidet über Erfolg. Transformation braucht psychologische Sicherheit, agile Führung, Lernräume und bereichsübergreifende Zusammenarbeit.
Transformation beginnt nicht "oben", sondern bei jedem Einzelnen. Sie gelingt, wenn wir Sinn stiften, Vertrauen schaffen und den Wandel gemeinsam gestalten. Aufbruch entsteht durch kleine Erfolge, Mut zum Lernen und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

Michael Kammerbauer ist seit April 2023 Leiter der Geschäftsstelle Digitale Verwaltung des Kantons Bern. Zuvor war er stellvertretender Leiter des Kompetenzzentrums Amtliche Veröffentlichungen und Leiter Informationstechnologien und Entwicklung in der Bundeskanzlei. In dieser Funktion verantwortete er unter anderem die Modernisierung des Informatiksystems für die amtlichen Veröffentlichungen. Vor seiner Tätigkeit in der Bundeskanzlei leitete er verschiedene Digitalprojekte in der Medienbranche. Als Mitglied des operativen Führungsgremiums der Digitalen Verwaltung Schweiz ist er für die Umsetzung der Strategie sowie die Erarbeitung des Umsetzungsplans mitverantwortlich.
Dr. Alexandra Collm: Digitale Visionen mit Stabilität und Innovation erreichenDie Umsetzung der neuen Digitalisierungsstrategie der Stadt Zürich baut auf Stabilität und Innovation. Was auf den ersten Blick paradox klingt, ist der Treibstoff, der die Organisation weiterbringt.
Eine moderne Digitalisierungsstrategie bereitet den Boden für digitale Visionen: Stabilität garantieren und Innovation freisetzen
Die digitale Transformation ist kein Sprint – sie ist ein Dauerlauf. Und sie verlangt von IT-Organisationen, zwei Dinge gleichzeitig zu meistern: verlässliche Stabilität im Kern und Innovation für die Zukunft. Wer dabei nur auf Betriebssicherheit setzt, verliert morgen den Gestaltungsspielraum.
Die Stadt Zürich verfolgt einen bi-modalen Ansatz mit einem klaren Verständnis für beide Modi. Dabei wird eine Struktur benötigt, die sowohl stabilisierende als auch innovationsfördernde Elemente integriert – ein Ansatz, der über die organisatorische Trennung hinausgeht und kulturell verankert werden muss. Genau hier setzt die Digitalisierungsstrategie der Stadt Zürich an.
Die Stadt Zürich verfolgt eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie, die:
- eine moderne IT-Infrastruktur als Basis nutzt,
- digitale Kompetenzen systematisch aufbaut,
- datengetriebene Entscheidungen und Transparenz über Projekte und Lösungen fördert,
- Kooperation und klare Strukturen sowohl für Effizienz als auch Innovation priorisiert.
Mit den Schwerpunkten bleibender Mehrwert, vernetzte Zusammenarbeit, verantwortungsvoller Technologieeinsatz und zukunftsfähige Kompetenzen werden Digitalisierungsvorhaben der Organisationseinheiten gezielt unterstützt und Mehrwert geschaffen. Konkrete Angebote wie Guidelines (z. B. zu Nutzendenzentrierung), Weiterbildungen zum Datenmanagement und Architekturberatung helfen zusätzlich bei der Umsetzung.
Anhand des Digitalisierungspfads der Stadt Zürich (z. B. "Mein Konto", M365, KI-Initiativen) wird sichtbar, wie digitale Reife Schritt für Schritt aufgebaut wurde – stets als kontinuierlicher Aushandlungsprozess, mit einem Verständnis für Stabilität und Innovation.
Insgesamt verlangt der erfolgreiche Dauerlauf der digitalen Transformation:
- die Verzahnung von IT und Fachbereichen,
- Vertrauen und Transparenz in interner wie externer Zusammenarbeit,
- und eine strategisch-kulturelle Ausrichtung, die sowohl Stabilität als auch kontinuierliche Innovationsfähigkeit absichert.

Dr. Alexandra Collm ist seit April 2017 Leiterin der Hauptabteilung Kunden und Mitglied der Geschäftsleitung der Organisation und Information der Stadt Zürich (OIZ). Zudem hat sie die operative Leitung der im Frühjahr 2024 verabschiedeten städtischen Digitalisierungsstrategie inne und hat das Programm Digi+ lanciert, beides mit dem Ziel, die Digitalisierung in der Stadtverwaltung zu beschleunigen. Zuvor war sie bei Swisscom in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem in der Konzernstrategie und im Business Development. Dr. Alexandra Collm ist diplomierte Verwaltungswissenschaftlerin und hat an der Syracuse Universität in den USA und der Universität St. Gallen promoviert, an der sie nach dem Doktorat auch ein Forschungsprogramm zu IT und Innovationsmanagement im öffentlichen und Non-Profit-Sektor führte.
Thomas Alabor: Wie die Bedag die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung unterstütztWie entstehen digitale Lösungen gemeinsam mit den Fachstellen? Was ist entscheidend, damit ein Prozess funktioniert?
Thomas Alabor von der Bedag zeigte in seinem Vortrag auf, wie die Bedag als IT-Dienstleisterin die kantonalen Verwaltungen bei der Digitalisierung unterstützt – nicht durch Tools, sondern durch das Verständnis für Fachprozesse und die Berücksichtigung der Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung. Anhand konkreter Beispiele wie Capitastra (Grundbuch) oder HelloDATA (Datenplattform) wurde deutlich: Erfolgreiche Digitalisierung entsteht dort, wo IT nicht vorgibt, sondern begleitet – fachlich fundiert, partizipativ entwickelt und rechtskonform umgesetzt.
Im Zentrum des Vortrags standen die spezifischen Rahmenbedingungen der öffentlichen Verwaltung: gesetzlich regulierte Prozesse, Gleichbehandlung, Datenschutz und demokratische Kontrolle. Statt technische Plattformen "von der Stange" zu forcieren, zeigte Thomas, wie digitale Lösungen gemeinsam mit den Fachstellen entstehen – modular, nachvollziehbar und anwendungsnah, professionell und innovativ.
Besonders betont wurde der Unterschied zwischen technikgetriebenem Stammdatenmanagement und fachzentrierter Datenverfügbarkeit: Nicht das Tool entscheidet, ob ein Prozess funktioniert – sondern das Verständnis für die dahinterliegende Fach- und Datenlogik. Nur so gelingt etwa die Umsetzung des Once-Only-Prinzips, wie es die Tallinn-Deklaration fordert.
Sein Fazit: Digitale Verwaltung gelingt dann, wenn Fachlichkeit und Technologie im Gleichgewicht stehen – und wenn der Dialog mit den Fachleuten den Ausgangspunkt für die Lösungsfindung bildet. Die Bedag bringt dafür nicht nur Technologie mit, sondern Verwaltungserfahrung, Augenhöhe und langfristige Partnerschaft.

Thomas Alabor ist ein erfahrener Experte im Bereich Informatik und Digitalisierung mit Schwerpunkt auf E-Government. Er ist seit über acht Jahren bei der Bedag Informatik AG tätig und verantwortet als Head Market & Portfolio die strategische Markt- und Portfolioentwicklung. Seine Arbeit konzentriert sich darauf, moderne Lösungen für den öffentlichen Sektor zu entwickeln, damit die Verwaltung sich auf ihre Beratungs-, Expertise- und Steuerungstätigkeiten konzentrieren kann.
In der Vergangenheit leitete Thomas Alabor strategische Digitalisierungsprojekte bei Bund und Kantonen, wie die Registerharmonisierung mit der Einführung der AHVN13 als Personenidentifikator, dem Aufbau von sedex und der elektronischen Datenlieferung an die Volkszählung. Beim Bundesamt für Statistik leitete er zudem das Unternehmensidentifikationsregister und beim Kanton Neuenburg war er verantwortlich für die Verwaltungsreform.
Thomas Alabor ist Vorstandsmitglied des Vereins eCH, der sich für die Standardisierung im Bereich E-Government in der Schweiz einsetzt. Er schreibt Beiträge zum Thema Digitalisierung und hält Gastvorlesungen an Hochschulen.
Zum Auftakt in den zweiten Teil des Tages – den Frühlingsapéro – unterhielt Patrick Karpiczenko alias Karpi, der bekannte Autor, Komiker, Speaker und Dozent für künstliche Intelligenz, die Gäste mit Einblicken aus seinem Alltag als Maschinenflüsterer.

Karpi ist sozusagen Duzis mit der KI und hat im Bierhübeli die Frage gestellt, ob Maschinen auch lustig sein können. Er zeigte dem Publikum, wie Volksinitiativen mit KI generiert werden können. Ein «Ja – zur Mitsingpflicht beim Sirenentest» oder «Ja - zur Volksinitiative für eine Vorstellungspflicht im ÖV» sind dann die Ergebnisse. Karpi begründete, wie schnell ChatGPT zu einem «bünzligen» Mainstreamtool wird und wie nun alle nach eigenem Gusto Bilder und Texte manipulieren können. Die künstliche Intelligenz macht alles möglich und damit auch beliebig:
- Ein «Papscht Bschtek Denkmal in Spiez» gefällig? Prompten und staunen.
- Wie sieht der durchschnittlichste aller Bundesräte aus? Alle Porträts hochladen und mergen.
Schnell wird künstliche Intelligenz zu künstlichem (und künstlerischem) Mittelmass. KI lässt DJ Bobo den «Schinken und Wurst Song» performen. Jede Schnapsidee erhält die Power zum medialen Viral-Hit zu verkommen (Nein, Trump will die Schweiz nicht kaufen. Das ist (Real-) Satire von Karpi – mit über sechs Millionen Klicks…). KI übersetzt, visualisiert, prototypisiert, standardisiert und halluziniert. KI verspricht, was das Leben nicht hält. Darum Vorsicht: Der Erfolg könnte Sie zwingen auch Blödsinn zu realisieren - so wie Karpi das Kindersachbuch «Meine erste Demo» aufgrund der vielen Vorbestellungen dann tatsächlich schreiben und gestalten (lassen) musste.
Beim anschliessenden Apéro Riche diskutierten unsere Gäste über die Referate der Key Note Speaker, trafen bekannte Personen wieder und vernetzten sich mit neuen. Auch der fünfte Innovationstag der Bedag wurde von den Teilnehmenden sehr positiv bewertet. Die Themen Digitalisierung, Innovation und KI sind und bleiben zukunftsweisend für uns alle. Darum freuen wir uns auf den nächsten Innovationstag 2026. Wann genau und wo er stattfinden wird, verraten wir noch nicht!